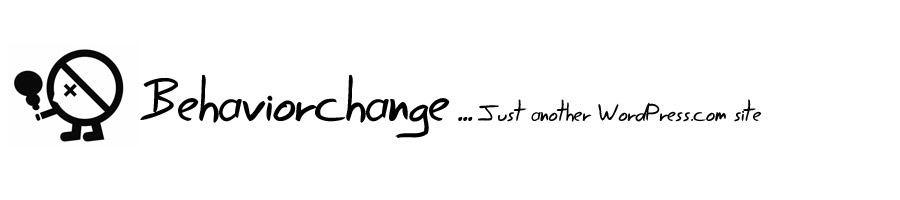Hirnscans verraten Hang zum Drogenmissbrauch
Veröffentlicht: April 30, 2012 Abgelegt unter: Forschung, Prävention, Suchtmechanismen | Tags: Anatomie, Biochemie, Drogenkonsum, Impulsivität, Kontrolle, Studie Hinterlasse einen KommentarJugendliche, die sehr impulsiv sind, probieren eher Drogen aus – sind daher stärker gefährdet, abhängig zu werden. In einer Studie mit knapp 1900 Teilnehmern haben Forscher jetzt Hirnregionen ausgemacht, die bei diesen Jungen und Mädchen ungewöhnlich reagieren.
Ein Hang zu Drogenmissbrauch lässt sich laut einer Studie bei Jugendlichen im Gehirn erkennen. Einige Teenager hätten ein höheres Risiko, mit Drogen und Alkohol zu experimentieren, weil bestimmte Eigenheiten ihres Gehirns sie impulsiver machten, schreibt ein internationales Forscherteam im Fachjournal „Nature Neuroscience“. Das Ergebnis helfe bei der Klärung der Frage, ob bestimmte Hirnmuster schon vor der Abhängigkeit existieren – oder erst durch längeren Drogenmissbrauch entstehen.Fast 1900 Jugendliche nahmen am der Studie von Robert Whelan und Hugh Garavan von der University of Vermont (USA) und ihren Kollegen teil. Für eine Untersuchung, bei der von jedem Probanden per funktioneller Magnetresonanz-Tomographie (fMRT) Aufnahmen des Gehirns angefertigt werden, ist das eine extrem hohe Teilnehmerzahl.Die 14-jährigen Jungen und Mädchen wurden gebeten, bei einem Test einen Knopf zu drücken. In einigen Fällen mussten die Teenager die Bewegung in letzter Sekunde stoppen – Menschen mit guter Impulskontrolle gelingt dies besser. Jugendlichen, die unter einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) leiden, fällt das dagegen schwerer. Ebenso haben Drogenkonsumenten größere Probleme bei der Aufgabe. Die Jugendlichen sollten zudem angeben, ob und welche Drogen sie bereits konsumiert hatten. Einbezogen wurden auch genetische Analysen.
Verschiedene neuronale Netzwerke beteiligt
Die Forscher konnten sieben Netzwerke im Gehirn ausmachen, die besonders aktiv waren, wenn die Jugendlichen den Prozess wie gewünscht kurzfristig abbrechen konnten. Sechs andere waren dagegen involviert, wenn die Probanden es nicht schafften.Eine Schlüsselerkenntnis: Bei den Jugendlichen, die bereits Alkohol, Zigaretten oder illegale Drogen ausprobiert hatten, war ein neuronales Netzwerk, zu dem der sogenannte orbitofrontale Cortex gehört, weniger aktiv. Es funktioniere bei einigen Kindern nicht so gut wie bei anderen – das mache sie impulsiver und damit auch anfälliger fürs Experimentieren mit Drogen, sagt Whelan. Der orbitofrontale Cortex – ein Teil des Frontallappens der Großhirnrinde – wird schon lange mit mangelnder Impulskontrolle und Drogenmissbrauch in Verbindung gebracht.Bei ADHS sind allerdings andere Netzwerke involviert, berichten die Forscher. Anders als bisher angenommen würden ADHS und ein Hang zum Drogenkonsum – obwohl beide mit mangelnder Impulskontrolle in Verbindung stehen – wohl nicht komplett über dieselben, sondern verschiedene Steuerkreise reguliert.Die Studie wurde von der Europäischen Union finanziell unterstützt. Sie ist Teil des Analyse-Projekts „Imagen“, bei dem europäische Wissenschaftler Daten von 2000 Jugendlichen aus Irland, Frankreich, England und Deutschland über Jahre erfassen und auswerten. An der aktuell präsentierten Studie waren Forscher aus Hamburg, Berlin, Heidelberg und Dresden beteiligt. Whelan betonte, dass die jetzt erkannten Muster bei einer normalen fMRT-Studie mit 16 bis 20 Teilnehmern nicht entdeckt worden wären.
wbr/dpa
Physiologische Grundlagen der Entstehung von Abhängigkeit
Veröffentlicht: Februar 21, 2012 Abgelegt unter: Suchtmechanismen, Suchtpsychologie, Tabkkonsum | Tags: Biochemie, Dopamin, Raucher, Sucht Hinterlasse einen KommentarAlle Phasen der Abhängigkeit spielen sich primär im gleichen kleinen Hirnareal ab: im Nucleus accumbens, dem so genannten „Belohnungssystem“. Es verbindet lebenswichtige Vorgänge wie Essen, Trinken und Sex mit einem Lustgefühl. Dazu schütten die Nervenzellen Botenstoffe aus, vor allem Dopamin. Nikotin steigert die Ausschüttung des Dopamins.
Das „Belohnungszentrum“ verknüpft die Umstände des Konsums mit der spezifischen Wirkung der Droge. Nikotin löst also eine wohlige Gefühlskaskade im Belohnungszentrum des Gehirns aus. Eine Zigarette beglückt den Raucher ähnlich wie ein Kuss oder ein gutes Essen. Diese „Belohnung“ wird direkt mit der Tätigkeit des Rauchens assoziiert.
Der regelmäßige Raucher wiederholt ständig seine „Erfahrung“, dass Rauchen eine beglückende Tätigkeit sei. Dies prägt sich tief in sein Unbewusstes ein, es entsteht ein sogenanntes „Suchtgedächtnis“. Dieses Gedächtnis wird aktiv, wenn der Spiegel an wirksamen Substanzen im Belohnungszentrum nachlässt, oder wenn der Raucher einen anderen rauchen sieht. Dann erwacht wieder das Verlangen nach einer neuen Dosis Nikotin.
Ein weiterer Aspekt ist die Vermehrung der Anzahl von Nikotinrezeptoren bei chronischem Nikotinabusus. Bei Untersuchungen an Gehirnen gestorbener Raucher wurden doppelt so viele Rezeptoren gefunden wie bei Nichtrauchern. Eine Hypothese ist, dass dadurch bei Kettenrauchern besonders viel Dopamin ausgeschüttet wird, was eine intensivierte Reaktion auf das Nikotin zur Folge hat. Allerdings ist das Phänomen reversibel: bei Ex-Rauchern sinkt die Anzahl der Nikotinrezeptoren wieder in den Normbereich. Das Suchtgedächtnis scheint jedoch eine irreversible Komponente aufzuweisen, die die Entwöhnungsschwierigkeiten erklärt.
Mit zunehmender Gewöhnung nimmt die Zahl der Rezeptoren zu, dafür werden sie unempfindlicher. Das Gehirn braucht größere Dosen der Droge.
Wissenschaftskritik im Rahmen der Nikotinprävention
Veröffentlicht: Februar 14, 2012 Abgelegt unter: Institutionen, Prävention, Suchtmechanismen, Suchtpsychologie, Werbung | Tags: Marketing, Nikotinprävention, Studie, Tabakindustrie, Wissenschaftskritik Hinterlasse einen KommentarKritik an Wissenschaft und an Wissenschaftsjournalismus ist in einer offenen Gesellschaft nicht nur legitim, sondern leider oft auch notwendig. Auch wenn dieser Gedanke manchen Standesvertretern nicht gefallen mag – es wäre das erste Jahrzehnt der Menschheitsgeschichte, in dem Wissenschaft fehlerlos wäre. Wer auf Denkfehler in der Wissenschaft stößt, hat die Pflicht, sie zu benennen. Die DGNP betrachtet viele Studien und Forschungen über das Rauchen mit Skepsis. Es ist eine Binsenweisheit, dass Studien manipulierbar sind. Es ist im Wissenschaftsbetrieb ein offenes Geheimnis, dass Studien von Drittmittelgebern oft zu den Ergebnissen führen, die sich Drittmittelgeber wünschen. Es ist zudem üblich, dass Journalisten die Kernaussagen von Studien veröffentlichen, wenn diese nur den Anschein haben, seriös zu sein.
Die DGNP ist daher im Umgang mit Studien äußerst vorsichtig. Nicht nur, weil bekannt ist, dass die Tabakindustrie über lange Jahre Forscher bezahlt hat, um ihre Interessen in der Wissenschaftslandschaft zu implementieren – selbst Forscher an Einrichtungen gegen das Rauchen. Und auch nicht nur, weil die Pharmaindustrie Nikotinprodukte herstellt und zugleich Forschungseinrichtungen finanziell unterstützt, die sich mit dem Rauchen befassen. Sondern auch, weil selbst der gut meinende Blick von Wissenschaftlern oft die wichtigen Themen verfehlt.Die DGNP hält zum Beispiel Studien über die Schädlichkeit des Passivrauchens für wenig erhellend. Dass das Passivrauchen schadet, gilt seit 1986 in den USA als Konsens. Keine Mutter, deren Baby man Rauch ins Gesicht bläst, braucht eine Studie, bevor sie ihr Kind in Sicherheit bringt – denn sie weiß: In eine Lunge gehört nur Luft. Mit dem gleichen Aufwand, den solche Studien erfordern, könnte man auch etwas gegen das Rauchen tun.
Viele Studien, von wohlmeinenden Instituten in Auftrag gegeben oder publiziert, demotivieren sogar Raucher beim Aufhören. In der Studie „Waist circumference and weight following smoking cessation in a general population“ von C. Pisinger und T. Jorgensen geht es beispielsweise um die durchschnittliche Gewichtszunahme infolge des Rauchstopps. Kernaussage: „Die durchschnittliche Gewichtszunahme bei 221 erfolgreichen Aussteigern betrug nach dem ersten Jahr Abstinenz etwas mehr als 4 kg pro Ex-Raucher.“ Die Botschaft für Aufhörwillige ist fatal: „Wer aufhört, nimmt zu.“ Doch das ist so nicht richtig. Es bedarf des Kontextes, den der rein empirische Ansatz nicht berücksichtigt.
Der Spruch „Rauchen macht schlank“ ist eine Erfindung des PR-Strategen Edward Bernays, ein Neffe Sigmund Freuds. Bernays erfand diesen Spruch in den 50er Jahren im Auftrag der American Tobacco Company, um neue Marktanteile unter Frauen zu erobern.
Da Raucher nicht durchgängig schlanker sind als Nichtraucher und viele Raucher übergewichtig sind, da Menschen mit gedrosselter Sauerstoffzufuhr zudem Nährstoffe schlechter verbrennen und Sport eher als frustrierend empfinden, ist diese Werbebotschaft bereits durch Alltagsbeobachtungen als unwahr zu entlarven.Der Kern des Phänomens ist leicht zu verstehen, wenn man ihn kennt: Das Gefühl „Ich brauche eine Zigarette“, also das Symptom des körperlichen Nikotinentzugs, fühlt sich etwa so an wie Hunger – es ist ein harmloses, schwaches Leeregefühl in Brust und Oberbauch, das nicht wehtut und das die meisten Raucher nachts nicht einmal weckt. Nach dem Rauchstopp kann dieses Gefühl noch einige Tage auftreten, vor allem dann, wenn man sich in bestimmten Auslösesituationen (Stress, Kaffee) an die Konditionierung zur Zigarette intensiv erinnert – etwa durch Therapieprogramme, in denen sich Ex-Raucher die Bedeutung nicht gerauchter Zigaretten vor Augen halten sollen. Indem man das Rauchen gedanklich weiter kultiviert, kann ein „Verzichtsgedanke“ entstehen und das Verlustgefühl kann aufgrund von Autosuggestion im Stile einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung als spürbare Illusion fortleben. Im ungünstigsten Fall „belohnen“ sich Ex-Raucher für den vermeintlichen „Verlust“ der Zigaretten mit Naschen und nehmen dadurch zu. Das scheinbare Hungergefühl verschwindet jedoch von ganz allein, wenn man sich nicht weiter damit befasst, sondern sich mit positiver Motivation auf sein künftiges Leben als Nichtraucher freut. Zudem kann die erhöhte Sauerstoffzufuhr infolge des Nichtrauchens grundsätzlich für eine bessere Nährstoffverbrennung sorgen, da der Körper nun meist schon von alleine mehr Bewegung verlangt.
Befragen Forscher 221 Ex-Raucher, ohne diesen Zusammenhang zu kennen, erhalten sie ein entsprechendes Ergebnis, das aufgrund der unterschlagenen Variable „kennt den Zusammenhang zwischen Nikotinentzug und Hunger / kennt ihn nicht“ auf die Gesamtpopulation der Ex-Raucher nicht übertragbar ist – aber auf Raucher im Allgemeinen demotivierend wirkt. Zumal eine durchschnittliche Gewichtszunahme von vier Kilogramm längst nicht bedeuten muss, dass auch der unwissende Ex-Raucher zwangsläufig zunimmt: In der entsprechenden Population halten etliche ihr Gewicht. Aufschlussreicher erschiene daher die Frage: Was haben die Zunehmer falsch und was die Gewichtsstabilen richtig gemacht?Ein weiteres, von Wissenschaftlern immer wieder ins Feld geführtes Argument ist die Sache mit dem Stoffwechsel. Leider betrachtet die Wissenschaft dieses für sich gesehen richtige Argument meistens ohne Kontext.
In der Tat verbrennen Raucher etwa 200 Kalorien pro Tag, die ein Nichtraucher nicht verbrennt, weil er dazu die Gründe nicht hat. Der Raucher hat sie: In komplexen physiologischen Prozessen muss der Körper die Folgen des Rauchens beseitigen. So stört das Kohlenmonoxid im Rauch den Sauerstoffaustausch in der Lunge, der ganze Organismus leidet unter Sauerstoffmangel und arbeitet daher unter Hochlast. Auch der Blutdruck steigt, und das kostet Energie. Zudem gleicht der Körper eines Rauchers einer Müllverbrennungsanlage: Raucher verarbeiten jeden Tag mehrere Dosen von mehr als 4000 Chemikalien, und auch zu deren Abbau benötigt der Körper Energie.
Diese Zusammenhänge begründen keine vernünftige Methode, schlank zu sein. Wieder Nichtraucher zu werden heißt, den schädlichen Einfluss zu stoppen und sich wieder in den Bereich des Normalen zu begeben. Warum sollte der Körper jetzt auf unnormal umschalten?Zudem ist es wichtig, das Stoffwechselargument ins richtige quantitative Verhältnis zu setzen: 200 Kalorien entsprechen etwa ein 50-Gramm-Müsli-Riegel ohne Schokolade oder einem Caesar-Salat mit gegrilltem Hühnerfleisch und Dressing bei einer bekannten Fastfood-Kette – eine Menge, die ein Ex-Raucher schon infolge der erhöhten Sauerstoff-Zufuhr problemlos verbrennen kann, wenn er sie in Bewegung umsetzt und die Zusammenhänge kennt.Zielführender als Studien übers Zunehmen und sinnvoller als beängstigende, mit sorgenvoller ärztlicher Miene vorgetragene Schwarzmalerei findet die DGNP die Aufgabe, Rauchern diese Zusammenhänge im Ganzen zu erklären und ihnen zu helfen, sie in ihrer Bedeutung richtig einzuordnen. Viel wichtiger als verwirrende Details ist es, Rauchern zu verdeutlichen, dass mit dem für Raucher gewohnten regelmäßigen Verlustgefühl nach dem Rauchstopp Schluss ist und dass die Angst vor Verzicht daher unbegründet ist. Mit dieser Erkenntnis und guter positiver Motivation leben Ex-Raucher vom ersten Tag an ohne Verlustgefühl. Sie halten nach dem Rauchstopp nicht nur ihre Figur, sondern nehmen infolge der erhöhten Sauerstoffzufuhr und besserer Körperwahrnehmung möglicherweise sogar ab – und fragen sich nach wenigen Tagen, warum so viele Wissenschaftler das Aufhören durch die Problem-Brille betrachten.
Quelle: http://www.nikotinpraevention.de/was_wir_wollen/wissenschaftskritik.html